| Zahnstangensysteme | |
| System Riggenbach | |
 |
Inzwischen, als in Amerika die Madison-Indianapolis-Bahn und das Zahnstange- system Marsh entsprangen, war aber auch in der alten Welt der Zahnradbahn ein Förderer von ungewöhnlicher Bedeutung erwachsen. Niklaus Riggenbach, geboren im Jahre 1817 zu Gebweiler im Elsaß, wurde, nachdem er 1847 als Werk- stättenchef von Emil Keßler in Karlsruhe die erste Lokomotive der schweizerischen Nordbahn nach Zürich gebracht, bald darauf zum Maschinenmeister der schweizerischen Zentralbahn und zum Direktor der Hauptwerkstätten in Olten ernannt. Seinem Dienste unterstellt war auch der 2,5 km lange Hauensteintunnel mit 26,23 v.T. Steigung, dessen Reibungsverthälnisse für den Maschinen- dienst von jeher viel zu wünschen übrig ließen. |  |
|
Riggenbach
kam daher auf den Gedanken, daß unter solchen Umständen eine
Lokomotive mit Zahnrad und eine Zahnstange, also ein von der gewöhnlichen
Reibung ganz unabhängiges Mittel, eine willkommene Lösung sein dürfte.
Pläne und Studien wurden daraufhin in Angriff genommen. Es entstand der Entwurf
einer Zahnradlokomotive mit liegendem Kessel, ganz in der Anordnung der
damaligen Keßler'schen Maschinen mit einem mittleren Zahnrade und dazu
eine Zahnstange mit gewaltzten Wangen und dazwischen gesteckten Zähnen mit
Trapezquerschnitt, welche seitlich durch Splinte festgehalten wurden. Auf diese
Anordnung erwirkte Riggenbach durch Vermittlung der Firma André Köchlin & Cie.
in Mülhausen ein Patent für Frankreich, welches das Datum vom 12 August 1863
trägt. |
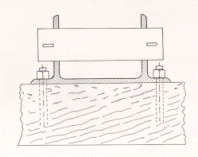 Zahnstange Riggenbach.
Zahnstange Riggenbach. |
Für die Zahnstange waren zwei Lösungen in Aussicht genommen. Die eine war aus einem
U Eisen mit seitlich angewalzten Schenkeln gebildet, die andere aus zwei aufrecht stehenden,
besonders geformten U Eisen, ähnlich einer einseitiger Breitfußschine. Die Verzahnung
war in beiden Fällen durch Querstäbe von trapezförmigem Querschnitte erzielt. Festgehalten
werden sollten die Zähne durch seitlich durchgesteckte Schließen. br> Ebenso waren auch zwei Arten Lokomotiven vorgesehen, für reinen und für gemischten Betrieb, mit liegenden Kesseln. Bei beiden erfolgte der Antrieb von den in gewöhnlicher Weise außen gelagerten Dampfzylindern aus auf eine vor der Feuerbüchse gelagerte Vorgelegeachse. |
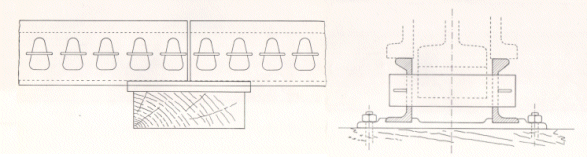 Zahnstange Riggenbach. |
|
Diese trug zwei kleine Zahngetriebe, welche in zwei Übersetzungsräder einer weiteren Achse, der eigentlichen Zahntriebachse, eingriffen, auf deren Mitte das Zahntriebrad gekeilt ward. Für gemischten Betrieb war diese letztere Achse durch Stangen mit einer Reibungstriebachse gekuppelt. In der Befürchtung, ein ungleich tiefer Eingriff möchte auf die Bewegung des Zahnrades störend wirken, waren neben dem Zahnrade zwei leerlaufende Tragrollen angeordnet, die sich auf die Wangen von der oben erwähnten Form der Zahnstange stützen. Die ganze Anordnung der Lokomotiven dentete darauf hin, daß sie für Bahnen mit mäßiger Steigung in Aussicht genommen waren. Die Konstruktion der Zahnstange ist nicht zur Ausführung gekommen, wohl aber später jene der Lokomotive. Für sehr starke Steigungen schwebte Riggenbach eine andere Lösung vor, nämlich eine gewöhnliche, einfache Zahnstange, ähnlich jener von Cathcart und darin sich abwickelnd ein Schneckenrad, dessen Antrieb entweder durch Dampf, oder unter Umständen auch durch Wasserkraft mittels entsprechender Übertragung durch Seil oder Preßluft erfolgen sollte. Riggenbachs unermüdliche Bemühungen zur Verwirklichung seiner Ideen sollten endlich eine ebenso unerwartete, wie günstige Unterstützung finden. Im Jahre 1867 war John Hitz, schweizerischer Generalkonsul bei den Vereinigten Staaten Nordamerikas, für einige Zeit in seiner Heimat und richtete an den schweizerischen Bundesrat einen ausführlichen Bericht über die am Mount Washington im Baue befindliche Zahnradbahn, mit dem allgemeinen Hinweis auf die Nützlichkeit solcher Anlagen in den Schweizerbergen und dem besonderen einer Verbindung zwischen dem Genfersee un der Stadt Lausanne, beziehungsweise Westbahnhof. Riggenbach, mit Hitz persönlich bekannt geworden, erhielt von diesem den Rat, auf den Rigi eine Bahn zu bauen, wie Silvester Marsh am Mount Washington. Damit war eine glückliche Wendung eingetreten. Eine Baustelle, die, wie sich bald herausstellte, glücklicher nicht gewählt werden konnte, dazu der in Amerika erbachte Nachweis, daß eine Zahnradbahn keine solche «Ungeheuerlichkeit» war, wie sie die Professoren am schweizerischen Polytechnikum in ihrem Gutachten an den schweizerischen Bundesrat dargestellt hatte, mußte neuen Mut verleihen und zum Siege helfen. Auf der Generalversammlung des schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins vom 27 bis 29 September 1868 in Interlaken, auf dem verschiedene Gebirgsbahnprojekte zur Besprechung kamen, hatte Riggenbach im vereine mit Olivier Zschokke noch einmal versucht, die Techniker für seinen Plan einzunehmen. Wenngleich unentschieden, zeigte sich doch eine größere Neigung für die neu aufgetauchte Bauart Wetlis. In dieser Stimmung wurde von Riggenbach, Zschokke und Oberst Adolf Naeff, des letzteren Geschäftgenossen, noch am 29 September der Entschluß gefaßt, auf den Rigi eine Zahnradbahn zu bauen. Zur Aufklärung sowie Feststellung der mechanischen Einzelheiten wurde Ingenieur Otto Grüninger nach dem Mount Washington entsendet und im Juni 1869 von demselben ein ausführlicher Bericht erstattet mit zahlreichen Skizzen der dortigen Ausführungen und höchst wertvollen Verbesserungsvorschlägen und Anregungen. Am 9 Juni 1869 erfolgte die von der Regierung des Kanton Luzern verlangte Genehmigung des baues einer Bahn Vitznau-Kaltbad-Staffelhöhe. Am 24 Juli gleichen Jahres erhielt sie die bundesrätliche Genehmigung und unmittelbar darauf sagten auch vier Banken ihre Mitwirkung zu. Das Aktienkapital wurde auf 1.250.000 Frs. angesetzt, wovon die Hälfte von den drei Unternehmern übernommen wurde. Im Oktober 1869 begannen die Arbeiten. Die Vollendung der 5 km langen Bahn war für den Hochsommer 1870 in Aussicht genommen, allein die bauarbeiten verzögerten sich etwas und plötzlich brachte der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges im Juli 1870 eine Störung in die Ablieferung der Schienen. Immerhin hatte im Mai 1870 die erste Probefahrt und genau ein Jahr später die Eröffnung des Betriebes stattgefunden. Was am Rigi zur Ausführung gelangte, waren weder die Zahnstange, noch die Lokomotive nach dem seinerzeit in Frankreich genommenen Patente Riggenbachs, sondern in allen wesentlichen Teilen, selbst bis auf einzelne Abmessungen genau, die Formen vom Mount Washington, jedoch mit so bedeutenden Vervollkommnungen, daß die mechanische Ausrüstung dieser Zahnradbahn gegenüber ihrem Vorbilde einen hochwichtigen Fortschritt bedeutet. |
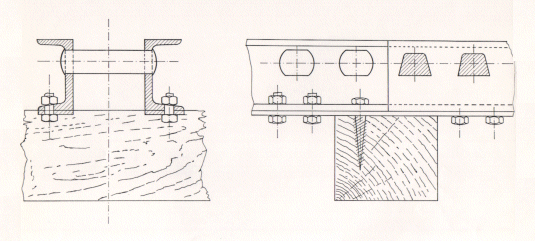 Zahnstange der Rigibahn. Erste Anordnung. |
|
Die Zahnstange am Rigi besteht aus zwei C Eisen als Seiten und dazwischengesteckten Zähnen von trapezförmigem Querschnitte. Diese letzteren ware, soweit sie im Stege der C Eisen steckten, angedreht und an den Enden vernietet. Jedes Zahnstangestück hat eine Länge von 3 m. Die Teilung beträgt 100 mm. Die Stöße befanden sich stets über einer Schwelle. Als Lasche dienten zwei Flacheisen von der breite der Schenkel der C Eisen. Die Befestigung auf den Schwellen erfolgte mittels Holzschrauben. |
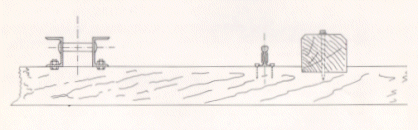 Alter Oberbau der Rigibahn. |
Die Schienen waren 80 mm hoch und wogen 15 kg/m. Neben denselben führten
hölzerne Langschwellen über die ganze Bahn. Als die Zeit einer Auswechslung der
hölzernen Schwellen rasch heranrückte, entschloß sich die Rigibahn, zum
eisernen Oberbau und gleichzeitig zu stärkeren Laufschienen überzugehen. |
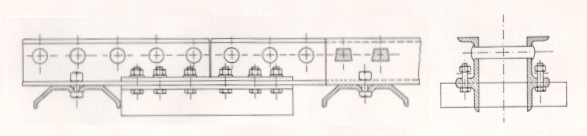 Zahnstange der Rigibahn. Neue Anordnung. |
|
|
In wenig Jahren war der Umbau durchgeführt. Die Lagerung der Zahnstange unmittelbar auf den Querschwellen hat den Vorteil größter Einfachheit für sich. Dagegen greift infolgedessen das Zahnrad tief herunter und erschwert dadurch auch die Anordnung der Weichen und Kreuzungen. Um diesem Nachteile zu begegnen, zeigen die spätere Riggenbachschen Bahnen eine Lagerung der Zahnstange auf gußeißernen Stühlen. Diese Anordnung findet sich bei sämtlichen späteren Bahnen gemischten Betriebs. |
|
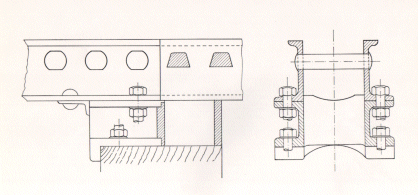 Zahnstange Riggenbach auf gußeißernen Stühlen. |
|
Nach einem neuen Gedanken wurde die Maschine gebaut. Sie ist eine Tenderlokomotive mit einer Lauf- und einer Triebachse. Von den Dampfzylindern aus wird die Bewegung auf eine Vorlegewelle und von dieser mittels Zahngetriebe und Ubersetzungsrad auf die Zahnradachse übertragen, außerdem geht vom Kurbelzapfen der Vorlegewelle auch eine Kuppelstange zur hinteren Achse. Diese ist doppelt, auf dem Kerne sind die beiden Kurbeln befestigt und außerdem eine Klauenkuppelung. Die äußere, hohle Achse trägt die Reibungstriebräder und in deren Nabe die entsprechende Hälfte der Klauenkuppelung. Während der langsamen Fahrt kann diese Kuppelung eingerückt werden. Es arbeitet dann die Maschine mit der Reibung der hinteren Achse, während das Zahntriebrad sich ebenfals mitdreht. Wird die Kuppelung zum Befahren der Zahnstange ausgerückt, so wird das Zahnrad allein angetrieben und die Achse für Reibungsräder folgt lose mit. Die Einfahrt in die Zahnstange gestaltete sich unter diesen Umständen ziemlich schwierig. Ein ungefähr 3 m langes, erstes Stück Zahnstange war auf Hebedaumen gelegt. Die Maschine mußte sich über dieses Stück stellen und nun wurde dasselbe durch Drehen der Daumen gehoben, insofern nämlich die Lage des Zahnrades gerade den richtigen Eingriff gestattete. War dies nicht der Fall, so mußte die Maschine wieder ein Stück zurück, dann wieder heranfahren und das so oft wiederholen, bis der richtige Eingriff sich einstellte. Die Ausfahrt dagegen erfolgte naturgemäß immer austandslos. Das von Riggenbach 1872 in den Vereinigten Staaten erwobene Patent bezieht sich auf diese Art der Einfahrt und die beschriebene Lokomotive. Im Jahre 1876 wurde eine zweite Maschine nach Ostermundigen geliefert mit steifer Kuppelung zwischen Zahn- und Reibungsrad, ganz im Sinne der ursprünglichen frazösisches Patentes. Bei diesem Anlasse wurde von R. Abt eine neue Zahnstangeneinfahrt erfunden und gebaut, welche das Einfahren in die Zahnstange selbsttätig und ohne Anhalten des Zuges erlaubte. |
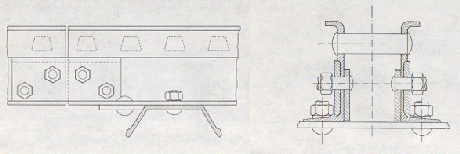 Cremallera «d'escala», derivat del de Riggenbach i que fou àmpliament utilitzat. |
Die Leiterzahnstange ist aber auch von anderer Seite wiederholt ausgeführt werden,
so namentlich von der Maschinenfabrik Bern, unter Anwendung wesentlicher
Verbesserungen. Nach diesen glücklichen Anwendungen war den Zahnradbahnen die Welt erschlossen. |
|
Unter persönlicher Mitwirkung Riggenbachs wurden 1874 die Kahlenbergbahn bei
Wien und die Schwabenbergbahn bei Budapest erbaut, beide reine Zahnradbahnen nach
dem Vorbilde am Rigi. In der Schweiz folgten 1875 zwei gleiche Ausführungen, die eine
von Arth aus auf den Rigi, die andere von
Rorschach nach Heiden. Die letztgennanten vier Bahnen brachten leider kein entsprechendes Erträgnis; der größte Teil des Anlagekapitals blieb zisenlos. Es mag das auf die weitere Entwicklung der Zahnradbahnen lähmend gewirkt haben. Eine von Riggenbach geleitete Maschinenfabrik in Aarau, insbesondere zum Baue der mechanischen Ausstattung von Bergbahnen bestimmt, hatte unter derselben Ungunst zu leiden und mußte 1879 geschlossen werden. Riggenbach übergab hierauf die Ausführung seines Systems der Maschinenfabrik Eßlingen, zog sich einige Jahre später ganz von den Geschäften zurück und starb im hohen Alter von 82 Jahren. |
|
| System Wetli | |
|
Noch während Riggenbach, anfänglich mit wenig Erfolg, seine Bemühungen
um Anwendung des Zahnstangenbetriebs fortsetzte, war ihm, wie oben
angedeutet, in R. Wetli, Kantonsingenieur von Zürich, ein Mitbewerber erstanden.
Im Jahre 1868 erfolgte über Wetlis Bauart die erste umfassendere Veröffentlichung.
Der theoretisch sehr schönen Idee war die Meinung vieler Techniker nicht ungünstig,
das Urteil der Professoren sehr zustimmend. Bald nach Erscheinen einer von
Professor Harlacher vom deutschen Polytechnikum in Prag verfaßten Schrift
über diese Konstruktion gelang es Wetli, eine Gesellschaft zur Ausführung seiner
Entwürfe zu bilden. Das Ziel war der Bau einer Bahn von Wädensweil am Zürichsee
nach dem weitbekannten Wallfahrtsorte Einsiedeln in einer Länge von rund
17 km. |
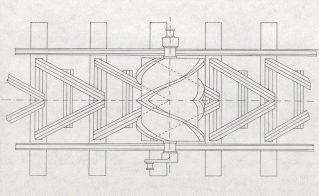 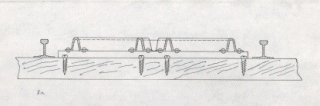 Oberbau Wetli. |
Das System Wetlis ist ein gemischtes. Die nämliche Maschine sollte sowohl die
Bahnstrecken mit gewöhnlichen Steigungen, also bis ungefähr 25 v.T. als
gewöhnliche Tendermaschine, wie auch höhere Steigungen, bis 80 v.T., mit vereinten
Kräften der Reibunstriebräder und eines walzenförmigen Zahnrades bewältigen,
welch letzteres beliebig durch Dampfkraft gehoben und gesenkt werden konnte. Im Jahre 1874 wurden auf einem etwa 400 m langen Stücke die ersten Probefahrten vorgennomen. Wenn auch nicht anstandslos, fielen sie doch so aus, daß der Weiterbau beschlossen und namentlich eine Vervollkommnung der Lokomotive angestrebt wurde. Im Hebst 1876 wurden mit der inzwischen fertig gestellten neuen Lokomotive weitere Proben ausgeführt, sie endeten aber am 30 November 1876 mit einem schweren Unfalle, den freilich die Bauart unmittelbar nicht verschuldet hatte. Die Folge davon war, daß die ganze Linie als gewöhnliche Reibungsbahn ausgebaut und seither als solche betrieben wurde. Der Oberbau Wetlis bestand in Querschwellen von Holz mit kräftigen Breitfußschienen; dazwischen, fast die ganze Gleisweite ausfüllend, Winkel aus Hohlschienen gebildet, in Abstand von 900 mm, so daß das Gleis die Form einer Winkelzahnstange erhielt. |
|
Das Triebrad hatte die Form einer Walze, auf die als Verzahnung ähnliche Winkelstücke wie jene des Oberbaues aufgenietet waren. Diese Triebachse war beständig in Bewegung, konnte aber, wie schon erwähnt, auf den flacheren Gefällen in die Höhe gehoben werden und drehte sich alsdann leer in der Luft. Die bei den Versuchen gefundenen Anstände waren hauptsächlich: Unregelmäßiges Anliegen der Verzahnung in den Bogen und bei ungenauer Lage des Oberbaues, infolge dessen starke Reibungswiderstände und Abnutzung. Bei Schnee und Eis dürfte wohl auch die Schwierigkeit, den Oberbau zu reinigen und damit einen genügend tiefen Eingriff zu sichern, fast unüberwindlich geworden sein. Einen zweiten Versuch hat diese Bauart seither nicht mehr erlebt. |
|
| © Eugeni Pont, 1998 |